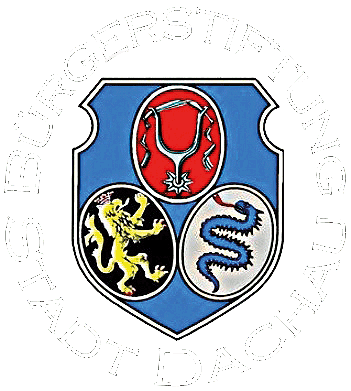Pierre de Porcaro
Inhaltsübersicht:
- Biografie

Foto: Association des amis de la Fondation de la Résistance
Kurzbiografie:
Pierre de Porcaro wird am 10. August 1904 in Dinan in der Bretagne geboren und am 29. Juni 1929 in Versailles zum Priester geweiht. Sein Vater, ein Offizier, fiel 1916 im Ersten Weltkrieg. Der Neupriester wird von 1929 bis 1935 Lehrer und Kapellmeister am kleinen Seminar Notre-Dame de Grandchamp in der Diözese Versailles, dann 1935 bis 1943 Vikar im ebenfalls bei Paris gelegenen St. Germain en Laye. Im August 1939 rückt er als Pionier-Unteroffizier ein und wird am 23. Juni 1940 in den Vogesen von der deutschen Armee gefangen genommen. In Deutschland kommt er ins Stalag IX B in Bad Orb in Hessen und kehrt am 4. August 1940 nach der Entlassung zurück nach St. Germain en Laye. Sein Bischof bittet ihn 1943, als illegaler Seelsorger für Zwangsarbeiter nach Deutschland zu gehen. Porcaro ist einverstanden reist am 13. Mai ab. Der ausgebildete Lehrer für Französisch, Latein und Griechisch ist nun in Dresden Hilfsarbeiter. Nach einem Arbeitsunfall bekommt er Urlaub in Frankreich, kehrt dann aber trotz des Risikos nach Dresden zurück. Ein Denunziant verrät ihn, und er wird am 20. Januar ins Konzentrationslager Dachau deportiert. Pierre de Porcaro erkrankt dort an Typhus und stirbt am 12. März 1945 im Krankenrevier des Lagers. Einem Gefährten sagt er kurz vor seinem Tod: „Ich biete mein Leben für Frankreich an, ich nehme das Opfer an, das der Herrgott mir schickt“. Am Rand der Todesurkunde werden 1947 die selben Worte wie 1916 für seinen Vater vermerkt: „Gestorben für Frankreich“.
Biografie von Klemens Hogen-Ostlender:
„Ich muss ein Heiliger werden“
Pierre de Porcaro wird am 10. August 1904 im bretonischen Dinan in der Villa des Fontaines in der Rue de Brest um 5 Uhr nachmittags geboren. Er empfängt am selben Tag wegen seines zunächst kritischen Gesundheitszustands die Nottaufe. Die Zeremonie wird am 30. November in der Pfarrkirche Heiliger Erlöser vollendet. Seine Eltern sind Edmond-Marie de Porcaro und dessen Ehefrau Marthe-Louise-Marie du Hamel de Canchy. Der Vater ist Kommandeur des 24. Dragonerregiments. Er wird am 8. November 1916 im Ersten Weltkrieg fallen. Pierre ist das dritte Kind der Familie. Der Erstgeborene Jean stirbt 1939 bei einem Flugzeugabsturz. Louise de Porcaro ist Pierres ältere Schwester, Yves und André de Porcaro seine jüngeren Brüder. Die Familie ist seit dem 15. Jahrhundert in der Region ansässig und stammt aus dem dortigen Dorf Porcaro. Am 29. Juni 1929 wird Pierre in Versailles zum Priester geweiht. Auch sein Bruder Yves empfängt später dieses Sakrament. Pierre schreibt während seiner Ordinationsklausur ins Tagebuch: „Ich muss ein Heiliger werden. Nur so kann ich mir später einen fruchtbaren Dienst sichern.“ Sechs Jahre lang ist er zunächst Lehrer und Kapellmeister am Versailler Kleinen Seminar Notre-Dame-de-Grandchamp. Bis zum August 1939 wird er dann als Vikar ins nur wenige Kilometer entfernte St.-Germain-en-Laye geschickt.
Nach dem er um 5.45 Uhr die Frühmesse gefeiert hat, wird Pierre de Porcaro bei Kriegsbeginn am Sonntag, dem 3. September 1939 als Korporal zum 10. Pionierregiment einberufen. Er will seinem Vaterland als Militärseelsorger dienen ohne zu vergessen, dass er Priester ist. Nach wenigen Wochen der Kämpfe gerät er im Juni 1940 in Gefangenschaft. Erste Station ist ein Kriegsgefangenenlager in einer Militärkaserne in Colmar. Dort werden 8.000 französischen Soldaten, darunter etwa 30 Priester, festgehalten.Täglich feiert man die Heilige Messe in der St.-Joseph-Kirche. Aus Colmar wird Pierre nach Deutschland verlegt, ins Stammlager IX-B im hessischen Bad Orb östlich von Frankfurt. Dort leiden die Gefangenen unter Hungerrationen und schlechten hygienischen Verhältnissen. Am Vorabend von Allerheiligen wechselt Pierre de Porcaro mit einem Amtsbruder zum Pfarrer von Bad Orb, Alfons Maria Lins, dem zwei Priester zugeteilt wurden. Man verständigt sich in der Muttersprache der Kirche, Latein. Der Deutsche sagt seinem Gast „Intentio mea non est pro vobis ad laborandum sed ad recreandum“ (Meine Absicht ist es nicht, Sie arbeiten zu lassen. Sie sollen sich erholen).
Auf dem Berg der Märtyrer
Am nächsten Tag ringt Pierre de Porcaro sich zu einem Entschluss durch: „Am Allerheiligenmorgen gebe ich meine vollständige Zustimmung. Am Anfang meiner Gefangenschaft habe ich revoltiert, aber ich habe mich dieser Prüfung unterworfen. Nun akzeptiere ich sie mit allem Gleichmut, auch wenn sie Jahre dauern sollte. Ein großartiger Tag, der mir durch die Gnade Gottes den vollkommenen Frieden und eine tiefe innere Freude beschert. Ich nehme alles an – alles, einschließlich dafür zu sterben [für diese Mission], in einem fremden Land zu sterben, weit weg von allem, weit weg von allen“. Am 3. August 1941 darf er nach Frankreich zurück, weil er kein kämpfender Soldat war. Am Vorabend seiner Rückkehr ins Seminar verharrt er in Paris vier Stunden lang im Gebet in der Kirche Sacré-Cœr auf dem Montmarte-Hügel. Mont Martre bedeutet „Berg der Märtyrer“. Ist es ein Vorzeichen dessen, was kommen wird? Pierre de Porcaro drückt seine Gemütsverfassung danach so aus: „Ich glaube, ich kann mit vollem Ernst sagen: Ich habe Durst nach Seelen“. Als er am nächstes Tag sein Amt als Vikar in St.-Germain-en-Laye wieder aufnimmt, ahnt er nicht, dass die Rückkehr an seine geliebte Wirkungsstätte nur eine Episode sein wird.
Priester mit falschen Papieren
Hunderttausende Franzosen müssen während des Krieges zum Zwangsarbeitsdienst in Deutschland antreten. Für sie verbieten die NS-Behörden jegliche seelsorgerische Betreuung. Der Priester Jean Rodhain wendet sich Anfang 1943 im Auftrag von Kardinal Emmanuel Suhard, dem Erzbischof von Paris, an alle französischen Bischöfe, um zu verhindern, dass all diese Arbeiter ohne Priester bleiben. Er wirbt für eine „Solution Saint Paul“, (Lösung Sankt Paulus) so genannt, nach einer Stelle im zweiten Thessalonicherbrief, wo der Völkerapostel schreibt „Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen“. Die Bischöfe sollen um Freiwillige werben, die bereit sind, mit falschen Papieren und ebenso erfundener Identität als Untergrundpriester nach Deutschland zu gehen. Das Vorhaben wird von Papst Papst Pius XII. ausdrücklich gebilligt. Rodhain zeigt sich zuversichtlich, der Klerus werde nicht zögern, seinen Teil der Bürde zu übernehmen, die auf der Arbeiterklasse lastet. Der Bischof von Versailles, Benjamin-Octave Roland-Gosselin, Pierres Vorgesetzter, wird später in seinen Erinnerungen schreiben: „Als man die französischen Bischöfe bat, Arbeiterpriester als Kapläne für die französischen Arbeiter nach Deutschland zu schicken, war ich, nachdem ich es vor Gott erwogen hatte, überzeugt dass niemand dafür besser geeignet wäre als Abbé de Porcaro“.
So fragt er den Vikar in einem Brief, ob er trotz des erheblichen Risikos für Leib und Leben diesen Dienst übernehmen und einen Arbeitsvertrag für eine Stelle irgendwo im Deutschen Reich abschließen würde. Das Schreiben kommt am Freitag vor dem Palmsonntag des Jahres 1943, dem traditionellen Gedenktag der Sieben Schmerzen Mariens, bei Pierre de Porcaro an. Er ist sich im Klaren darüber, dass der Nationalsozialismus unerbittlicher Feind alles Christlichen ist. Das hat auch das 1939 in Paris erschienene Buch „Gespräche mit Hitler“ des Autors Hermann Rauschning gezeigt, dessen Authentizität von einigen Historikern angezweifelt wird. Der nach Frankreich emigrierte konservative deutsche Politiker hat sich nach vorübergehender Mitgliedschaft von der NSDAP getrennt. Das Buch bringt das Ziel der NS-Ideologie auf den Punkt:„Man hat in Deutschland methodisch und mit unbeugsamer Logik den Vernichtungskampf gegen alles, was christlich ist, unternommen“ [aus dem Französischen rückübersetzt].
Der große Sprung ins Unbekannte
Pierre de Porcaro notiert spontan: „Gibt es am Ende überhaupt noch Grund zum Nachdenken? Der Bischof äußert einen Wunsch. Was für einen Dank schulde ich Gott, dass er mir in der Gefangenschaft die Rolle des Bischofs durch den Heiligen Geist verständlich gemacht hat! Eine Diskussion ist daher nicht möglich. Morgen früh fahre ich nach Versailles. Ich sage im Voraus ja“. Er fügte gleichwohl hinzu: „Ich glaube, es ist das größte Opfer, das man von mir verlangen konnte, denn in der Gefangenschaft habe ich mich hartnäckig geweigert, zu arbeiten“. Trotzdem betrachtet er das Apostolat als Untergrundpriester als Ehrenposten. Am Karfreitag, dem 23. April, bringt er diese Worte zu Papier: „Ich habe gerade den Kreuzweg gebetet. Ich habe besonders über den Auftrag an Simon von Cyrene nachgedacht. Ich möchte Christus helfen, sein Kreuz zu tragen. Meine Abreise hat keinen anderen Zweck“.
Der „große Sprung ins Unbekannte“, wie er es selbst nennt, fällt Pierre de Porcaro nicht leicht. An einem weiteren Freitag, dem 7. Mai, schreibt er zwei Wochen später: „Ich sagte Fiat und trat ein, meinen Rosenkranz fest umklammert. Es ist vollbracht. Der Vertrag ist unterzeichnet. Der Angst, der unerträglichen Qual folgt ein Frieden, eine immense, vollkommene Freude. Man spürt, was es heißt, mit freiem Willen ausgestattet zu sein. Nichts und niemand konnte mich zwingen“. Nach dem Besuch beim Bischof bekennt er: „Ich sagte ,Fiat´ und ging hinein. Auf die Angst und die qualvolle Not, die ich von 12 bis 15.30 Uhr erlebt hatte, folgte nach dem Verlassen des Büros ein Frieden, eine totale Freude. Jetzt, da ich mich entschieden habe, kann ich nicht mehr zurück“.
„Ein würdiger Sohn seines Vaters“
Nach dem Pierre seiner Mutter seinen Entschluss mitgeteilt hat, schreibt die ihrem 39jährigen Sohn mit der damals in gutbürgerlichen Kreisen üblichen Anrede: „Mein Kleiner, Sie wissen, was Ihr Vater und ich Ihnen immer beigebracht haben: Die einzige Sache, an die man sich im Leben halten muss ist es, seine Pflicht zu tun“. Pierres Onkel teilt sie brieflich mit: „Sie können stolz sein auf Pierre. Er ist ein würdiger Sohn seines Vaters“. Seinem Bischof schreibt der Vikar vor dem Aufbruch nach Dresden am 13. Mai 1943: „Als Lehrer für Französisch, Latein und Griechisch werde ich nun als ungelernter Arbeiter eingestellt”.
Abbé Jean Rodhain, der sich in Berlin freiwillig um in Deutschland arbeitende Franzosen kümmert, schildert die Lage im NS-Reich in diesen Tagen so: „Hier liebt man es zu glauben, dass die Christliche Religion überwunden sei. Aber im Gegenteil macht sich, insbesondere in ihrer katholischen Integrität, die Lebendigkeit des Christentums der französischen Arbeiter bemerkbar“. Eine zunächst nominell selbstständige französische Delegation kümmert sich in Deutschland um ihre Landsleute im Service du Travail Obligatoire dem „obligatorischen Arbeitsdienst“, wie die Zwangsorganisation beschönigend bezeichnet wird. Anfang Mai 1943 wird diese Delegation dann eine direkte Abteilung der „Deutschen Arbeitsfront“. Sämtliche Personalunterlagen geraten damit in den Zugriff der Gestapo.
Ankunft in Dresden
Am Montag, dem 17. Mai 1943, kommt Pierre die Porcaro mit dem Zug in Dresden an. Er wird als Arbeiter der Kartonfabrik Osthushenrich-Werke in der Zietenstraße 21 im westlichen Stadtteil Cotta zugeteilt. Heute heißt die Straße Mohorner Straße. Statt nach dem preußischen General zu Zeiten Friedrichs II. ist nun die nicht weit entfernte Gemeinde Mohorn Namensgeberin. Die Gegend ist aber immer noch gewerblich genutzt. Porcaro hält fest: „Ich wurde einer Fabrik für Wellkarton zugeteilt. Wir wohnen dort in der zweiten Etage“. Fünf junge Männer von 20 Jahren sind nun seine Kameraden. Einer gehört der Christlichen Arbeiterjugend an. Er stammt ebenfalls aus dem Großraum Paris und kennt Pierres Bruder Yves. Am ersten Sonntag geht der der Neuankömmling in die 9-Uhr-Messe in der Kathedrale des Bistums Dresden-Meißen, die Katholische Hofkirche, deren Patrozinium die Heiligste Dreifaltigkeit ist. Er knüpft sogleich Kontakte zu freiwillig in der sächsischen Hauptstadt arbeitenden Landsleuten, die die 8-Uhr-Messe besucht haben, und lernt auch Franzosen kennen, die danach in die 10-Uhr-Messe gehen.
Als Pierre de Porcaro erfährt, dass sich jeden Dienstag nur zehn Kilometer entfernt Mitglieder der Christlichen Arbeiterjugend treffen, geht er auch dorthin. In der Gemeinde „Heilige Familie“ in Dresden-Zschachwitz lernt er Pfarrer Dr. Ludwig Baum kennen, den er so beschreibt: „Ein außerordentlich sympathischer Priester, der sehr gut französisch spricht“. Baum hat französische Katholiken zu den Treffen eingeladen. Spontan wird die Begegnung nun zu einem Studienkreis mit 17 Teilnehmern umfunktioniert. Der Pfarrer schlägt für den Abend des 25. Mai eine Diavorführung über die Schönheiten der Stadt vor. Pierre de Porcaro überlegt kurz und tut dann etwas, das er ursprünglich gar nicht vorhatte. Er hat schnell Vertrauen zu Ludwig Baum gefasst und bittet ihn um ein Gespräch unter vier Augen. Abseits von Ohrenzeugen tut der Franzose etwas das ihm eigentlich strengstens verboten ist und das ihn in Lebensgefahr bringen könnte. Im Garten offenbart er seine wahre Identität mit drei Worten: „Ich bin Priester“. Der deutsche Pfarrer gratuliert ihm zu seinem Entschluss, trotz der Risiken, die er in Deutschland eingeht, sein Land zu verlassen. Er verspricht Porcaro ohne Zögern, ihm bei seinem Apostolat zu helfen und ihm auch bei den zahlreichen Beichten der Franzosen beizustehen.
Vereint durch die Nächstenliebe Christi
Dr. Ludwig Baum entschließt sich auch, den Gruppen der Katholischen Aktion einen Saal für ihre Zusammenkünfte zur Verfügung zu stellen. Er erlaubt sogar eine geheime Messe jeden Sonntag, meist um 8.30 Uhr. Beim ersten Mal kommt gerade einmal etwa ein Dutzend Franzosen. Aber bald sind es 150 und schließlich 350 Teilnehmer. Am Sonntag, dem 11. Juli 1943 notiert Pierre de Porcaro: „Nach meiner Messe um 13 Uhr mit Predigt, gehalten vom bewundernswerten deutschen Pfarrer in Dresden, sehr großer Eindruck: Die katholische Kirche vereint Rassen, Nationalitäten und Leidenschaften durch die Nächstenliebe Christi“. Aber bald ändert sich die Atmosphäre. Anfang August charakterisiert ein Mitglied der Christlichen Arbeiterjugend sie so: „Wir sind gezwungen, diese Messe zu streichen, da die Gestapo aufmerksam geworden ist. Am nächsten Samstag hat Pierre uns gesagt: Die Jagd auf Priester hat begonnen“. Bei der deutschen Botschaft in Paris entsteht in dieser Zeit tatsächlich ein Bericht über „Gefährliche Intrigen des französischen Klerus“. Darin heißt es: „In den letzten Wochen häufen sich die Fälle, in denen hochgestellte Mitglieder der Geistlichkeit in Frankreich in ihrer Propaganda, in pastoralen Briefen und Gesprächen öffentlich Position gegen den Dienst französischer Arbeiter im Reich beziehen“. Der Chef des Reichssicherheitshauptamts, SS-Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner, beginnt mit der Arbeit an einem Dekret, das das gesamte Apostolat für die französischen Arbeiter in Deutschland verbieten wird.
Die Situation Porcaros verschärft sich auch durch die Kollaboration der zur Vichy-Regierung gehörenden Vertretung der freiwilligen Arbeiter in Deutschland mit dem NS-Regime. Sie beginnt eine zunächst versteckte Verfolgung der Action Catholique. Am 23. Oktober 1943 berichtet der Untergrundpriester in einem Brief, der nach Frankreich geschmuggelt wird, dass ein französischer Delegierter der Organisation in Berlin die Christliche Arbeiterjugend als anti-sozial bezeichnet hat. Ein anderer will sie und weitere Bewegungen verbieten. Porcaro schreibt: „Arme kleine Leute, sie glauben, sie hätten eine Mission und könnten das Reich Christi, das durch seine Apostel verbreitet wird, aufhalten. Ich bin Feind Nummer 1“. Auf Lateinisch bekräftigt er, dass er dazu nicht schweigen wird: „Non possumus, non loqui“ - „Wir können nicht nicht reden“. Pierre de Porcaro begreift, dass er mehr und mehr ins Visier seiner Feinde gerät.
Heimaturlaub
Am 16. November 1943 hat er in der Fabrik einen Arbeitsunfall. Eine Kartonrolle von mehr als dreieinhalb Zentnern Gewicht fällt ihm auf den linken Fuß. Ein doppelter Bruch ist die Folge. Der Fuß wird eingegipst. Der Arzt verordnet dem Patienten vier Wochen Ruhe und will ihn nach Frankreich schicken. Der Fabrikdirektor stimmt zu. Aber die Deutsche Arbeitsfront behauptet, in den Zügen sei kein Platz für Porcaro. Nach einer Woche Hin und Her erfährt der Franzose aber, am 8. Dezember 1943 könne er doch fahren. Am 10.12.1943, zwei Tage vor dem dritten Adventssonntag, kommt er tatsächlich in Saint-Germain-en-Laye an. Der erste Weg führt ihn zu Mutter und Schwester. In der Pfarrgemeinde will jeder Teil haben am unerwarteten Wiedersehen. Pierre de Porcaro könnte ohne Probleme in Frankreich bleiben. Aber das ist nicht das, was ihm vorschwebt. Vor der Rückfahrt wird er es auf den Punkt bringen: „Ich fühle mich verwirrt angesichts der göttlichen Aufmerksamkeiten. Ich entdecke die Arbeitermentalität, eine ungeheure Bereicherung in moralischer und erst recht in spiritueller Hinsicht[...] Mein Apostolat ist delikat, aber spannend. Die modernen Katakomben. Wir sind 22 in Deutschland. Sechs sind verhaftet, drei bereits nach Frankreich zurückgeschickt worden. Die anderen werden bald an der Reihe sein. Im vollen Vertrauen, in voller Hingabe, in voller Liebe biete ich dem lieben Gott diesen neuen Lebensabschnitt, vielleicht den letzten, an. Wie er will!“ Am Tag der Abfahrt schreibt er. „In einigen Stunden fährt der Zug. Wer die Hand an den Pflug legt und sich noch einmal umschaut, ist meiner nicht wer, heißt es in der Schrift. [. . .] Was wird morgen sein? Nur Gott weiß es. Nur er weiß und führt“.
Ohne die geringste Furcht
Am 22. Januar 1944 bringt er dies zu Papier: „Er [Gott] allein weiß und führt, immer mit Liebe. Ein einziges Wort – kein Fiat mit Gepränge, das gut ist für eine Bühne, kein automatisches Fiat, weil man es eben so gewohnt ist, sondern ein lebendiges, dynamisches Fiat, das alles gibt und nichts zurückhält. Dias zweite Fiat ist übrigens viel weniger hart als das Erste, weil ich weiß, wohin ich gehe, auch wenn ich die Abenteuer nicht vorhersehen kann. Vollkommene Hingabe“. Am 25. Januar 1944 ist Pierre de Porcaro wieder zurück in Dresden. Anfang April notiert er: „Die Fastenzeit ist ohne Zwischenfall verlaufen und Ostern ist gekommen. In allen Lagern, in denen es wahre Aktivisten gibt, hat die Zahl der Kommunionempfänger unsere Erwartungen übertroffen. In einigen waren es 50 Prozent, in größeren 25. Welche wunderbaren Dinge wirkt doch das Geheimnis Gottes!“
In einem Brief in die Heimat lässt er durchblicken: „Wenn er in die Klinik kommt, wird sein Apostolat schmerzlicher für ihn, aber auch fruchtbarer“. Er nennt das Gefängnis aus Gründen der Tarnung vor etwaigen Zensoren Klinik und berichtet über sich selbst in der dritten Person, als wenn er über einen Kameraden anmerken würde, weiter: „Glücklicherweise versichert man mir, und ich glaube es, dass er diese Operation ohne die geringste Furcht betrachtet, auch wenn der Klinikaufenthalt lang sein könnte“. Am 15. August schreibt Pierre de Porcaro noch einmal seinem Bischof in Versailles und versichert ihm, dass er seine Mission bis zum Schluss erfüllen wird, wie er es ihm in die Hand versprochen hat. Er schildert seine Lebensumstände ungeschönt, fügt aber hinzu: „Schließen Sie aus dieser Beschreibung nicht, dass mein Dasein sehr hart sei. [. . .] Die Gnade wiegt die Schwierigkeiten auf.“
Die Verhaftung
Sieben Tage, ehe Pierre de Porcaro im Heimaturlaub ankam, hat Ernst Kaltenbrunner persönlich sein Dekret unterzeichnet. Danach sind alle französischen „Priester, Seminaristen und so weiter“, die sich „in irgendeiner Weise durch schädigende Handlungen oder Äußerungen hervorgetan haben“ zu verhaften und ihm persönlich zu melden. Gruppen der Christlichen Arbeiterjugend müssen unverzüglich aufgelöst werden, antideutsche oder spionageähnliche Tätigkeit „erfordert eine Verlegung in ein Konzentrationslager“. Der 11. September 1944 ist ein Montag. Als Pierre de Porcaro an diesem Morgen die Fabrik betritt, wird er verhaftet. Der deutsche Pfarrer Robert Neumann aus der Nachbargemeinde Heidenau, mit dem Porcaro mehrfach zusammengetroffen war, erinnert sich später: „Als er im September 1944 verschwand, haben der Dresdener Propst Wilhelm Beier, Dr. Baum und ich versucht, im Polizeipräsidium etwas über ihn herauszubekommen. Aber es war nicht möglich. Erst sehr viel später haben wir erfahren, dass er in Dachau das Martyrium erlitt wie so viele unserer Freunde“. Auch Dr. Ludwig Baum ist mit zum Polizeipräsidium gegangen. Er hat mit Sicherheit gewusst, dass er selbst in Gefahr war, auch wenn er den Wortlaut von Punkt 6 im Anhang 2 des Dekrets Kaltenbrunners nicht kannte: „Gegen deutsche katholische Geistliche, die die Christliche Arbeiterjugend oder die illegalen Aktivitäten französischer Geistlicher unterstützt haben, müssen je nach Einzelfall und unter Berücksichtigung der polizeilichen Meldungen, die gegen sie vorliegen, geeignete strenge Maßnahmen ergriffen werden“.
Pierre die Porcaro hatte sein Quartier in den Osthushenrich-Werken längst verlassen und stattdessen als Untermieter beim Steuersekretär Franz Widuch und dessen Familie in der am Feldherrenstraße (heute Florian-Geyer-Straße) in der Dresdner Altstadt gewohnt. Für diese Familie und alle anderen Kontaktpersonen war er nun spurlos verschwunden. Der deutsche Pfarrer Neumann, mit dem Porcaro mehrfach zusammengetroffen war, wird sich später erinnern: „Als er im September 1944 verschwand, haben der Dresdener Erzpriester Beyer, Dr. Baum und ich versucht, im Polizeipräsidium etwas über ihn heraus zu bekommen. Aber es war nicht möglich. Erst sehr viel später haben wir erfahren, dass er in Dachau das Martyrium erlitt wie so viele unserer Freunde“. Als Ludwig Baum mit zum Polizeipräsidium ging, wusste er mit Sicherheit, dass er selbst in Gefahr war, auch wenn er den Wortlaut von Punkt 6 im Anhang 2 des Dekrets Kaltenbrunners nicht kannte: „Gegen deutsche katholische Geistliche, die die Christliche Arbeiterjugend oder die illegalen Aktivitäten französischer Geistlicher unterstützt haben, müssen je nach Einzelfall und unter Berücksichtigung der polizeilichen Meldungen, die gegen sie vorliegen, geeignete strenge Maßnahmen ergriffen werden“. Franz Widuch versucht im Dezember 1945 ebenfalls, etwas über den Verschwundenen zu erfahren. Erst danach erfährt er, dass die Gestapo seinen Untermieter verhaftet und zunächst ins Gefängnis im Polizeipräsidium von Dresden eingewiesen hat.
Der französische Seminarist Evode Beaucamp, der danach mit Pierre de Porcaro ins Dresdner Zentralgefängnis eingeliefert wird, erinnert sich später: „Ich höre noch sein sonores Lachen, als wir zu den Zellen hinaufstiegen. Er kam in die 2, ich in die 4“. Die beiden Häftlinge verständigen sich immer abends um sechs während der Wachablösung, nachdem sie zu den kleinen Fenstern hochgeklettert sind. Nach seiner ersten Vernehmung sagt Pierre zu Evode: „Ich habe ihnen alles gesagt, vor allem über den Grund meiner Ankunft in Deutschland. Ich bin sehr glücklich. Sie werden tun, was sie wollen.“ Und der Leidensgenosse verrät über die Haft mit Pierre de Porcaro: „Ich bin mir bewusst, dass ich in seiner Gesellschaft eine der schönsten Seiten in der Geschichte der Kirche erlebt habe“. Albert Lafarge, der zur Zwangsarbeit nach Dresden verschleppt wurde, wird später bezeugen, dass Pierre de Porcaro ihm bei seinen Bemühungen geholfen hat, einigen Gefangenen die Flucht zu ermöglichen.
Schikanen im Gefängnis
Über eine der letzten Begegnungen gibt er nach dem Krieg zu Protokoll: „Kurz vor seiner Verhaftung hat Pierre kommen sehen, was geschehen würde. Er hat mir etwa dies gesagt: ,Albert, wenn ich jemals festgenommen werde, muss man die menschliche Seite sehen. Ich wäre gezwungen, meine Handlungen hier zu rechtfertigen‘. Zum Schutz des Freundes, sollte dieser auch verhaftet werden, fügte er hinzu: „Ich werde sagen, dass unsere Aktivitäten ausschließlich sozial waren, Krankenbesuche, Gespräche über allgemeine Themen, Reisen, alte Geschichten, aber nichts Religiöses“. Albert Lafarge gerät tatsächlich noch in die Fänge der Gestapo und wird einen ganzen Tag lang von einem Beamten verhört, der auch Pierre e Porcaro vernommen hatte. Er kommt aber wieder frei und wird nicht wieder von der Geheimpolizei behelligt, wohl weil die Bombenangriffe vom 13. bis 15. Februar 1945 nicht nur große Teile der Stadt, sondern auch das Gebäude der Gestapo zerstören.
Die Widuchs versuchen vergeblich, Pierre de Porcaro Nahrungsmittel und Kleidung ins Gefängnis zu bringen. In der Haft wird er Opfer von Schikanen. Die Wärter werfen zum Beispiel sein Brevier in die blecherne Mülltonne. Ein Mithäftling berichtet nach dem Kriegsende, auch, dass Pierre die Porcaro mit seiner moralische Stärke in jeder Situation, mit seinen lustigen Geschichten und seinem ansteckenden Lachen einen Kreis um sich schuf, in dem er sein Apostolat fortsetzte und mit seinen Kameraden im Elend des Kerkers den Rosenkranz betete.
Tod im KZ Dachau
Am 20. Januar 1945 wird Pierre de Porcaro in den Priesterblock im Konzentrationslager Dachau eingeliefert, wo bis zum Kriegsende mehr als 2700 Geistliche inhaftiert waren, von denen mehr als 1000 getötet wurden. In der schier endlosen Liste der Neuzugänge verzeichnet ein SS-Hauptscharführer den Häftling 138 374 zwischen Cyrill Hartl aus dem böhmischen Beneschau (138 373) und Norbert Hirtzinger aus Diekirch in Luxemburg (138 375). Nur etwa sieben Wochen lang überlebt der Untergrundpriester die unmenschliche Behandlung im KZ bei katastrophalen hygienischen und medizinischen Verhältnissen, stirbt dann aber am 12. März 1945, dem Montag der vierten Woche der Fastenzeit, im notdürftig ausgestatteten Krankenrevier an einer Typhus-Infektion. Dieser Krankheit fielen damals viele der insgesamt mehr als 32.000 KZ-Insassen zum Opfer. Kurz vor seinem letzten Atemzug vertraut Pierre de Porcaro dem mitgefangenen Vikar Robert Beauvais aus Paris noch sein Vermächtnis an: „Ich opfere mein Leben für Frankreich. Ich akzeptiere das Opfer, das mir der Herrgott auferlegt.“ Sterbefälle sind in jenen Tagen trauriger Alltag im Priesterblock des Konzentrationslagers Dachau. Trotzdem wird für jeden heimgegangenen Kameraden in der Kapelle ein feierliches Requiem zelebriert.
Am 13. März geht der Prediger in Pierre de Porcaros Seelenamt auf die Tatsache ein, dass er seinen Tod hätte vermeiden können, wenn er nach dem Genesungsurlaub aus Frankreich nicht nach Dresden zurückgekehrt wäre, und zieht eine historische Parallele: „Das Opfer Christi war seinem Wesen nach freiwillig [. . .] Da seine Seele bereits die Herrlichkeit genoss, hätte er diesen körperlichen Tod verhindern können, aber er wollte es nicht. Der Begriff „freiwillig” erhält somit eine ganz besondere Bedeutung. Gemäß der Schriftstelle Jesaja 53,7 wurde er geopfert, weil er es wollte – oblatus est, quia ipse voluit“. Vikar Edmond Cleton, der das KZ Dachau überlebt, würdigt nach der Befreiung des Lagers seinen getöteten Kameraden so: „Abbé de Porcaro, einer der fähigsten, fröhlichsten und gelassensten unter uns. Er schloss sich Pater Dillard an [der am 12. Januar 1945 im KZ Dachau starb]. Beide waren Freiwillige, Zeugen Christi inmitten der Verbannten, von allen geliebt. Sie hinterlassen uns menschliche Trauer, aber auch die Hoffnung auf den Himmel.“
Weltliche Ehrungen
Yves de Porcaro berichtet nach dem Krieg, dass Pierre ihm schon während seines Urlaubs im Dezember 1943 etwas anvertraut hat: Er wusste bereits, dass er an die Gestapo verraten war. Er offenbar auch unter dem Siegel der Verschwiegenheit über seinen eigenen Tod hinaus den Namen seines Judas. Der Bruder empfindet gegenüber dem Verräter und den mit den Deutschen kollaborierenden Funktionären keine Rachegelüste, sondern ausschließlich Mitleid und betet für sie. Yves de Porcaro wird sein Wissen am Ende seines Lebens mit ins Grab nehmen. Im Frankreich des Jahres 1945 kurz nach dem Kriegsende hätte es dem Verräter durchaus passieren können, dass jemand nach dem alttestamentarischen Prinzip „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ eine so verstandene Gerechtigkeit in die eigenen Hände genommen hätte. Warum die Gestapo Pierre die Porcaro so lange noch hat gewähren lassen, ist unbekannt. Hoffte sie, ein großes katholisches Netzwerk aufzudecken? Die entsprechenden Akten wurden im zerstörten Dresdner Hauptquartier der Geheimpolizei wohl vernichtet.
Das französische Ministerium für Kriegsveteranen und Kriegsopfer erteilte Pierre de Porcaro am 24. Dezember 1947 posthum den Status als politischer Deportierter. Am 17. März 1948 erhielt seine Todesurkunde den Vermerk „Für Frankreich gestorben“.
In Saint-Germain-en-Laye wurde der Vorplatz der Kirche Saint-Germain in „Place de l'Abbé Pierre de Porcaro“ umbenannt.
2025 veröffentlichte ein französischer Verlag in Zusammenarbeit mit der Diözese Versailles einen Comic mit dem Titel „Pierre de Porcaro, prêtre clandestin volontaire“ (Pierre de Porcaro, freiwilliger Untergrundpriester).
Bildtexte
Porcarostatue: Diese Statue erinnert in Saint-Germain-en-Laye an Pierre de Porcaro Originalfoto: Widsith Creative Commons Attribution-Share-Alike 3.0 Unported License.
Photoporcaro:Abbé Pierre dePorcaro. Foto: Séminaire deVersailles
porcaro comic: Die Zeichnung aus dem 2025 erschienen Comicheft zeigt den Moment, in dem Pierre de Porcaro den Willen Gottes erkennt, nach einem Urlaub nach Deutschland zurück zu gehen. Der übersetzte Text lautet „Mein Gott, nach dem Lager, dem Hunger, dem Ungeziefer rufst Du mich wirklich wieder dahin zurück?“ Foto: Archiv Hogen-Ostlender