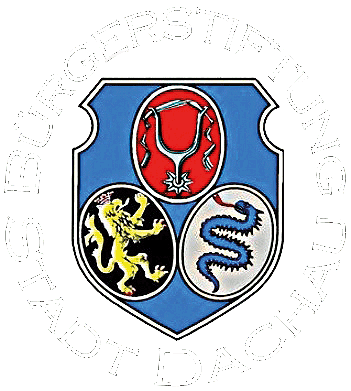Foto: Block 26 auf dem Gelände der Gedenkstätte des KZ Dachau, Ort der Kapelle im Priesterblock. Rechte beim Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V.
Die Initiative "zumfeindgemacht" des Bundesverband Information & Beratung für NS-Verfolgte e.V. veröffentlichte zusammen mit der Gedenkstätte des KZ Dachau einen empfehlenswerten Beitrag über die Geistlichen im KZ Dachau auf Instagram im Rahmen einer Reihe über Herrmann Scheipers. Link
Es wurde eine Reihe über die Verfolgung von Herrmann Scheipers veröffentlicht, der als junger Geistlicher in den Priesterblocks gefangen war und als letzter der Geistlichen vor wenigen Jahren hochbetagt starb. Link
Um finanzielle Unterstützung wird gebeten.
Spendenkonto
DE54 7005 1540 0280 8019 29
BYLADEM1DAH